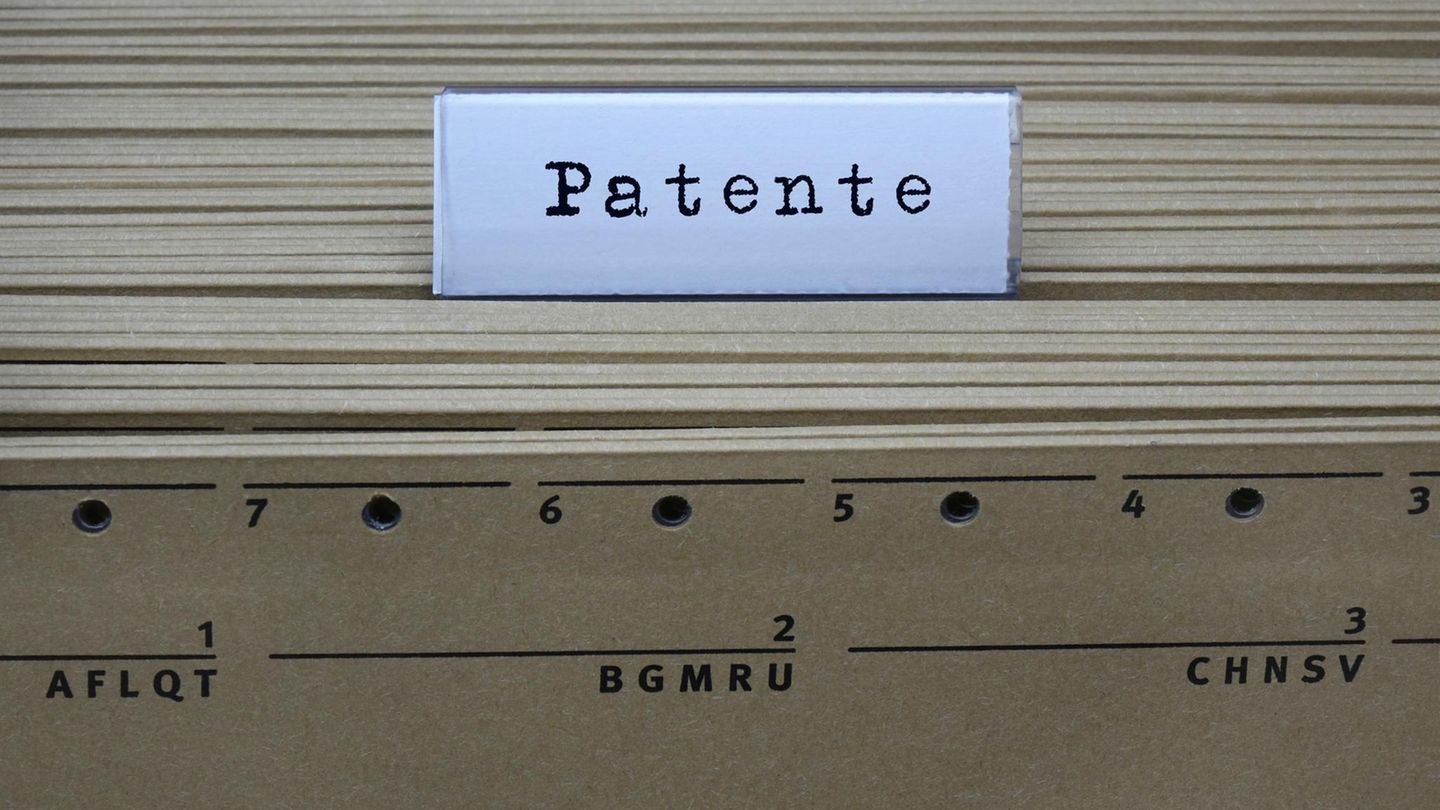Seit 2023 gab es umfangreiche Weiterentwicklungen im europäischen Patentrecht. Für deutsche Unternehmen bietet das Chancen und Risiken zugleich, schreibt Nina Bayerl
Jedes Unternehmen, das Forschung und Entwicklung betreibt oder auch nur für die Optimierung von internen Abläufen ein Interesse am Schutz (technischer) Entwicklungen hat, weiß um die Relevanz von Patenten. Eine grundsätzliche Entscheidung fällt häufig zwischen dem Schutz von Entwicklungen als Geschäftsgeheimnisse oder mittels eines Patents. Beides hat seine Vor- und Nachteile, und beides kommt mit eigenen Voraussetzungen.
Als Geschäftsgeheimnis lässt sich grundsätzlich alles schützen, sofern – strenge – Anforderungen an den Geheimnisschutz erfüllt sind. Es bleibt geheim und seine (gerichtliche) Durchsetzung ist mitunter schwierig. Patente wiederum werden in einem förmlichen Erteilungsverfahren vergeben und müssen dafür besondere Voraussetzungen erfüllen. Sie werden veröffentlicht, sind zeitlich auf grundsätzlich 20 Jahre begrenzt, gerichtlich aber im Regelfall einfacher durchsetzbar als Geschäftsgeheimnisse.
Eine Besonderheit von Patenten ist die territoriale Beschränkung des Schutzes. Patente wurden in der Vergangenheit in Europa für jedes Land einzeln erteilt. Erleichtert wurde bis vor kurzem lediglich die Anmeldung über die Möglichkeit einer zentralen Patentanmeldung für ein „Europäisches Patent“ beim Europäischen Patentamt für eine Gruppe von bis zu 39 Ländern (inklusive aller EU-Mitgliedstaaten).
Auch dieses „Europäische Patent“, wenn einmal zentral erteilt, „zerfällt“ jedoch in nationale Schutzrechte. Möchte ein Patentinhaber die aus diesem „Europäischen Patent“ resultierenden nationalen Schutzrechte für seine Erfindung halten, muss er für jedes Land Gebühren zahlen. Möchte er sie durchsetzen oder verteidigen, muss er dies (mit Ausnahme des zentralen Einspruchsverfahrens, das unmittelbar nach Erteilung möglich ist) jeweils vor den nationalen Gerichten tun. Das kann nicht nur mit erheblichen Kosten einhergehen, sondern auch mit gewisser Rechtsunsicherheit, da die nationalen Gerichte über Jahrzehnte teils unterschiedliche Maßstäbe konkretisiert haben.
Neues Einheitspatent, neues Patentgericht
Drei Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre verändern das nun grundlegend. Insbesondere für in Deutschland ansässige Unternehmen begründet das Chancen und Risiken zugleich.
Erstens: Seit dem 1. Juni 2023 gibt es nun auch ein „Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“, auch Einheitspatent genannt. Im Unterschied zum klassischen „Europäischen Patent“ gilt dieses Einheitspatent auch nach seiner Erteilung zentral fort. Entsprechend wird nur eine einheitliche Jahresgebühr fällig. Das lohnt sich im Regelfall ab gewünschtem Patentschutz in mindestens vier Mitgliedstaaten. Ebenso wird dieses Einheitspatent zentral gerichtlich durchgesetzt und verteidigt. Ein Wermutstropfen: Bisher machen nur 18 Länder mit, EU-Mitgliedstaaten wie Spanien, Polen oder Irland sind (noch) nicht mit dabei.
Zweitens: Ebenfalls am 1. Juni 2023 hat das Einheitliche Patentgericht (kurz: EPG) seine Pforten geöffnet. Dabei handelt es sich um das erste internationale Zivilgericht, das es je gegeben hat. Das EPG ist zuständig für Einheitspatente und, unter bestimmten Voraussetzungen, für Europäische Patente. Eine Entscheidung des EPG entfaltet zentral Wirkung in bis zu 18 EU-Mitgliedstaaten – dieselben wie diejenigen beim Einheitspatent. Die steigenden Fallzahlen indizieren den Erfolg dieses neuen Gerichtssystems und seine wirtschaftliche Relevanz. Unternehmen wie BioNTech/Pfizer, Gucci, Lenovo, Apple, Panasonic, Moderna, Mammut, Abbott, Sanofi, Xiaomi, Novartis oder Boehringer Ingelheim sind bereits an Verfahren beteiligt.
Drittens: Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die Möglichkeit für grenzüberschreitende Entscheidungen auf Basis von Patenten jüngst sogar noch weiter gefasst. Zusammengefasst erachtet es das Gericht in seiner Entscheidung BSH/Electrolux als europarechtskonform, dass beispielsweise ein deutsches Gericht über Patentverletzungen eines in Deutschland ansässigen Unternehmens urteilt, auch wenn diese Patentverletzungen (nur) in anderen Ländern erfolgen, wie beispielsweise in anderen EU-Mitgliedstaaten, aber auch in Großbritannien oder in der Türkei. In der Theorie ist nicht einmal eine Reichweite in die USA oder nach Asien ausgeschlossen.
Das begründet für in Deutschland ansässige Unternehmen vor allem deshalb ein erhebliches Risiko, weil die Feststellung einer Patentverletzung seitens eines deutschen Gerichts regelmäßig ohne weitere Voraussetzungen auch mit einer Unterlassungsanordnung, also einem Vertriebsverbot für das patentverletzende Produkt einhergeht. Im Übrigen sind deutsche Gerichte nicht nur für die hohe Qualität, sondern auch die Schnelligkeit ihrer Entscheidungen bekannt. Wie die deutschen Gerichte hiermit und insbesondere mit etwaig abweichenden Anforderungen nach dem ausländischen Recht umgehen, ist aber noch nicht klar.